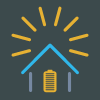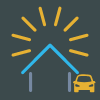Energieverbrauch Well to Wheel


CO2-Rucksack
Der CO2-Rucksack entsteht dadurch, dass für die Batterieproduktion ein relativ großer Energieeinsatz nötig ist. Dadurch benötigt die Herstellung eines Elektroautos mehr Energie als die Herstellung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Falls diese Energie nicht aus erneuerbaren Quellen kommt, entsteht dadurch ein entsprechend größerer Ausstoß von Treibhausgasen.
Dabei handelt es sich allerdings um ein relativ einfach zu lösendes Problem: Setzt man in der Batterieproduktion (bzw. noch besser: in der gesamten Fahrzeugproduktion) auf erneuerbare Energien, so entfällt der CO2-Rucksack (fast) komplett und die komplette Ökobilanz stellt sich auf den Kopf.
Der Verbrenner allerdings verbrennt weiterhin mit jedem Kilometer, den er fährt, kostbare Ressourcen und entlässt Treibhausgase in die Atmosphäre und schädliche Stickoxide und Rußpartikel in die direkte Umgebung.
Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? Zum Vergleich Elektroauto vs Verbrenner und insb. zur Ökobilanz von Elektroautos gibt es zig Studien. Und alle kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Manche behaupten sogar, einen Verbrenner zu fahren sei ökologischer als ein Elektroauto. Begründet wird das oft mit dem sog. CO2-Rucksack der Batterie verbunden mit der (Fehl-)Annahme dass der aktuelle Graustrom-Mix für Batterieproduktion wie auch für die gesamte Betriebsdauer als Fahrstrom genutzt wird. Dass der Energiemix mit den Jahren grüner wird, wird dort ebenso ausgeblendet wie die Wahlmöglichkeit, Ökostrom (oder noch besser: Strom aus der eigenen PV-Anlage) zu laden.
Klar ist: Batterieproduktion und Fahrstrom beeinflussen die Ökobilanz. Je nachdem, welche Annahmen der entsprechenden Studie zugrunde liegen, braucht das Elektroauto mehr oder weniger Jahre um in der Ökobilanz das Verbrenner-Pendant zu überholen. Im echten Leben kann jeder selbst entscheiden, welchen Fahrstrom er „tankt“ und dadurch mit seinem Verhalten das Rennen im Vergleich Elektroauto vs Verbrenner für sich entscheiden.
Mitten im Wandel
Selbstverständlich ist heute auch in der Elektromobilität noch nicht alles perfekt. Abbaubedingungen für Rohstoffe sind oft nicht besser als die in anderen Branchen. Vielleicht muss der Anspruch der Branche an sich selbst hier ein höherer werden. Insbesondere aber müssen die erneuerbaren Energien noch gewaltig ausgebaut werden bis ganz von selbst jeder gefahrene Kilometer „grün“ ist.
Es ist nicht sinnvoll, zu warten bis 100% Erneuerbare Energien im Netz sind um erst dann damit zu beginnen, den Fahrzeugbestand auf Elektrofahrzeuge umzustellen.
Wir befinden uns eben mitten im Wandel (bzw. eher am Anfang des Wandels). Und eines ist sicher: Es ist nicht sinnvoll, zu warten bis 100% Erneuerbare Energien im Netz sind um erst dann damit zu beginnen, den Fahrzeugbestand auf Elektrofahrzeuge umzustellen, insbesondere dann nicht wenn die Alternative heißt: Erdöl verbrennen. Denn dann ist selbst unter den schlechtesten Annahmen (Batterieproduktion und Fahrstrom beides Graustrom) im Vergleich Elektroauto vs Verbrenner das Elektroauto noch die grünere Alternative.
Aber viel wichtiger: Wir müssen „vom Ende her denken“ und sehen, wo wir hinkommen wollen, nämlich zu einem System, basierend auf 100% Erneuerbaren Energien, wenigstens in der Stromversorgung, und zu nachhaltigerem Mobilitätsverhalten mit einem insgesamt kleineren Pkw-Bestand. Die Veränderung wird nicht von heute auf morgen stattfinden sondern viele Jahre dauern. Wir müssen sie deshalb heute starten, auch wenn noch nicht alles zu 100% perfekt ist.
Elektroauto Vs Verbrenner: Effizienz von der Quelle bis zum Fahrenden Fahrzeug
Lasst uns also diese „Nebenkriegsschauplätze“ an dieser Stelle ausblenden und mal auf den Kern blicken, auf die Effizienz der Fortbewegung von der Quelle bis zum fahrenden Fahrzeug („Well to Wheel„).
Wir nehmen an, dass für alle Fälle gleichermaßen (unabhängig vom Energieträger) ein Energieeinsatz von 11,6 kWh nötig ist um 100 km weit zu fahren (netto, ohne Verluste). Basierend darauf schauen wir uns an, was in der gesamten Kette von der Quelle bis auf die Straße an (Primär)-Energie aufgewandt werden muss um am Ende die 11,6 kWh für Bewegung auf die Straße zu bringen.
Wir fangen mit dem Klassiker an, dem „effizienten“ Diesel:
Fall 1: Verbrenner (Diesel)
54,1 kWh
- Erdöl + Aufwand für Förderung
Für 100 km Fahrleistung in einem sparsamen Diesel wird zunächst an der Quelle in einem weit entfernten Land Erdöl mit einem Energieinhalt (Heizwert) von 51 kWh aus dem Boden geholt.
Für die Förderung werden weitere 3,1 kWh eingesetzt.
50,6 kWh
- Diesel
...um in einer Raffinerie mit einem Energieeinsatz von ca. 5 kWh in Treibstoff verwandelt zu werden.
45,6 kWh
- Diesel
Der fertige Treibstoff wird dann ins Tankstellennetz verteilt.
Für alle Transportwege von der Quelle bis zur Tankstelle setzen wir insgesamt 0,8 kWh an.*
Dafür, dass ein solch irrer Aufwand betrieben wird, ist dieser Prozess eigentlich ziemlich effizient.
So landet der größte Teil der bis hier dem Prozess zugeordneten Energie auch im Tank, nämlich immerhin 45,2 der insgesamt eingesetzten 54,1 kWh.
Andererseits: Allein mit den bis hierher aufgelaufenen Verlusten könnte ein Elektroauto schon einen Großteil der 100-km-Strecke zurücklegen.
45,2 kWh
- Diesel
45,2 kWh stecken in 4,6 Litern Diesel. Die mit Abstand höchsten Verluste fallen erst jetzt im letzten Umwandlungsschritt im Verbrennungsmotor an. Dort gehen ganze 33,6 kWh verloren. 11,6 kWh werden in Fortbewegung umgesetzt.**
11,6 kWh
- Bewegung
11,6 kWh werden bei sparsamer Fahrweise benötigt, um das Fahrzeug 100 km zu bewegen.
* wird für diese Darstellung je zur Hälfte dem Transportweg vor und nach Raffinerie zugerechnet
** Das entspräche einem Wirkungsgrad von knapp 26%. Manch einer hätte hier vielleicht eine Zahl von 40% oder mehr erwartet. Solche Wirkungsgrade werden für Motoren häufig angegeben. Sie erzielt der Motor allerdings nur im optimalen Arbeitspunkt. Bei Teillast fällt der Wirkungsgrad auf deutlich niedrigere Werte. Ein großer Nachteil von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist außerdem die fehlende Rekuperation. Jeder Bremsvorgang führt zu Verlusten und im Gegensatz zum Elektroauto wird nicht ein Teil davon zurückgewonnen.
Fall 2: Elektroauto fährt mit 100% Kohlestrom
Manch selbsternannter „Wissenschaftler“ argumentierte schon, für den Betrieb von Elektroautos sei zusätzlicher Strom nötig und da dieser noch nicht im System vorhanden sei, müsse dieser als 100% Kohlestrom bilanziert werden.
Zwar kann ich dieser Argumentation nicht ganz folgen. Warum sollte ein Elektroauto weniger Anrecht auf Ökostrom haben als ein Kühlschrank? Und selbst wenn, wäre das nur eine Momentaufnahme, die sich mit mehr Grünstrom im Netz mit der Zeit ändern wird. In nicht allzu ferner Zukunft werden die „fahrbaren Stromspeicher“ netzdienlich ge- und vor allem auch entladen werden können und können dann als Pufferspeicher für überschüssigen Sonnen- oder Windstrom eingesetzt werden. Das ist ein zentraler Baustein einer gelungenen Energiewende. Das wird ein Kühlschrank nicht können. Damit würde sich die (ohnehin schräge) Argumentation ins Gegenteil umkehren.
Wir schauen trotzdem – rein interessehalber – mal, wie die Kette Kohle – Hitze – Strom – Bewegung gegenüber der Kette Erdöl – Diesel – Hitze – Bewegung abschneidet, auch wenn es diesen Fall im echten Leben so gut wie nie gibt:
40,8 kWh
- Kohle + Aufwand für Förderung
Ca. 5 kg Kohle werden abgebaut und ins Kraftwerk transportiert. Dafür müssen ca. 3,3 kWh eingesetzt werden.
37,5 kWh
- Kohlestrom
Bei der Verbrennung wird eine Energiemenge von 37,5 kWh frei. Davon gehen 21,2 kWh bei der Umwandlung im Kraftwerk verloren.
Weitere 2 kWh gehen bei der Verteilung im Stromnetz verloren.
14,3 kWh
- Kohlestrom
Von den insgesamt eingesetzten 40,8 kWh kommen 14,3 kWh am Elektroauto an. 2,2 kWh gehen beim Laden und Entladen der Batterie verloren und weitere 0,5 kWh im Elektromotor.
11,6 kWh
- Bewegung
11,6 kWh werden bei sparsamer Fahrweise benötigt, um das Fahrzeug 100 km zu bewegen.
Elektroauto mit Kohlestrom gewinnt Im Vergleich Elektroauto VS Verbrenner gegen Diesel
Im Vergleich Elektroauto vs Verbrenner gewinnt also sogar ein Kohle-befeuertes Elektroauto gegen den sparsamen Diesel. Wie kann das sein?
Das liegt vor Allem daran, dass das Kohlekraftwerk praktisch immer im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden kann während das Kraftwerk auf Rädern – der Verbrennungsmotor – sehr viel unter Teillast laufen muss. Die Verluste im Kraftwerk sind dadurch deutlich geringer als im Verbrennungsmotor. Die zusetzlichen Umwandlungsverluste (Kohle-Hitze-Bewegung-Strom-Bewegung vs. Erdöl-Diesel-Hitze-Bewegung) fallen dabei weniger ins Gewicht.
Das soll aber natürlich trotzdem nicht der Maßstab sein. Wie wir alle wissen, sollte ein Elektroauto idealerweise mit Grünstrom betrieben werden. Erst dann kommen seine ökologischen Vorteile richtig zur Geltung.
Fall 3: Elektroauto mit erneuerbaren Energien
16,3 kWh
- Erneuerbare Energien
Die Sonne scheint auf Solarmodule oder der Wind treibt Windturbinen an. Ein Teil der Energie, die in Wind oder Sonnenstrahlung enthalten ist, wird in Strom umgewandelt. Die Energie, die dabei nicht "verwertet" wird, ist nicht verloren und hat auch keine schädlichen Nebeneffekte.
Verluste entstehen erst später (im Stromnetz und im Fahrzeug). Für unsere 100 km benötigen wir an der Quelle 16,3 kWh Grünstrom.
Davon kommen ganze 14,3 kWh am Fahrzeug an. Das ist auch kein Wunder. Schließlich haben wir von Anfang an den Energieträger in der Form, in der er beim Endverbraucher benötigt wird.
14,3 kWh
- Grünstrom
2,2 kWh gehen beim Laden und Entladen der Batterie verloren und weitere 0,5 kWh im Elektromotor.
11,6 kWh
- Bewegung
11,6 kWh werden bei sparsamer Fahrweise benötigt, um das Fahrzeug 100 km zu bewegen.
Und was ist mit Wasserstoff?
Mit Wasserstoff meine ich an dieser Stelle grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus (überschüssigem, sofern vorhanden) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Es handelt sich also um einen Sonderfall von Fall 3. Als Speichermedium wird nun Wasserstoff anstelle eines Akkus genutzt. Der Strom wird nicht ins Netz eingespeist und andernorts in die Batterie eines Elektroautos geladen sondern er wird zunächst genutzt um Wasserstoff zu produzieren. Dieser muss dann transportiert und unter hohem Druck gespeichert werden. Im Fahrzeug schließlich wird Wassersoff in einer Brennstoffzelle wieder zu Strom gemacht und mithilfe einer Pufferbatterie und eines Elektromotors in Bewegung umgesetzt.
39,1 kWh
- Erneuerbare Energien
Für unsere 100 km werden an der Quelle 39,1 kWh benötigt. Wir gehen davon aus, dass die Wasserstoffproduktion nah an der Quelle stattfindet und keine (relevanten) Netzverluste anfallen.
27,1 kWh
- Wasserstoff
...und weitere 6,4 kWh bei Transport und Speicherung. 20,7 kWh kommen als Wasserstoff im Tank des Fahrzeugs an.
20,7 kWh
- Strom
Davon gehen bei der Umwandlung in der Brennstoffzelle weitere 8,6 kWh verloren und 0,5 kWh im Elektromotor.
11,6 kWh
- Bewegung
11,6 kWh werden bei sparsamer Fahrweise benötigt, um das Fahrzeug 100 km zu bewegen.
Es kann durchaus eine gute Idee sein, aus überschüssigem erneuerbarem Strom Wasserstoff zu erzeugen. Wann wir allerdings wirklich genügend überschüssige Energie haben werden, um in großen Mengen Wasserstoff zu produzieren, steht aktuell noch in den Sternen. Fraglich ist außerdem, ob grüner Wasserstoff nicht anderswo wertvoller ist als im Pkw.
Quelle: die zugrundeliegenden Zahlen habe ich der Broschüre „Klimaschutzfakten über die Elektromobilität.“ vom gemeinnützigen Verein ElectrifyBW übernommen.
Gesamtwirkungsgrad "Well to Wheel"
Mit den Zahlen aus den obigen Darstellungen ergeben sich über die gesamte Kette von der Quelle bis auf die Straße die folgenden Wirkungsgrade.
CO2-Ausstoß Elektroauto Vs. Verbrenner
In der C02-Bilanz Elektroauto vs. Verbrenner wird der Unterschied zwischen Erst- und Letztplatziertem noch gravierender. Beim E-Auto mit Erneuerbaren Energien ist der CO2-Ausstoß im Betrieb schließlich nahe Null während mit jedem Liter verbranntem Diesel Treibhausgase in die Atmosphäre entweichen. Hier schneidet auch der grüne Wasserstoff gut ab. Dafür ist im Vergleich zum Elektroauto „nur“ deutlich mehr Erneuerbare Energie nötig.
Elektromobilität und Solarenergie sind ein unschlagbares Duo
Fahren Sie mit der Kraft der Sonne, mit dem Strom aus Ihrer eigenen Solarstromanlage.
Noch besser als ein E-Auto...?
Noch besser als ein E-Auto ist ganz klar: gar kein Auto. Oder wenigstens ein geteiltes (E-)Auto. Wer sein Auto mit anderen teilt, der teilt auch seinen ökologischen Fußabdruck.
Auch E-Autos brauchen viel Platz und stehen die meiste Zeit nur ungenutzt herum. Den Platz könnte man sinnvoller und schöner nutzen.
Mindestens genauso wichtig wie es ist, Verbrenner durch E-Autos zu ersetzten, ist also eine echte Mobilitätswende, die den Namen verdient, mit einem Wandel in Richtung Mikromobilität und Sharing.
Amrum erleben
Unsere Ferienwohnungen: strandnah | familienfreundlich | ökologisch | ganzjährig buchbar.
Haus Achtern Strand | Ferienwohnungen auf Amrum